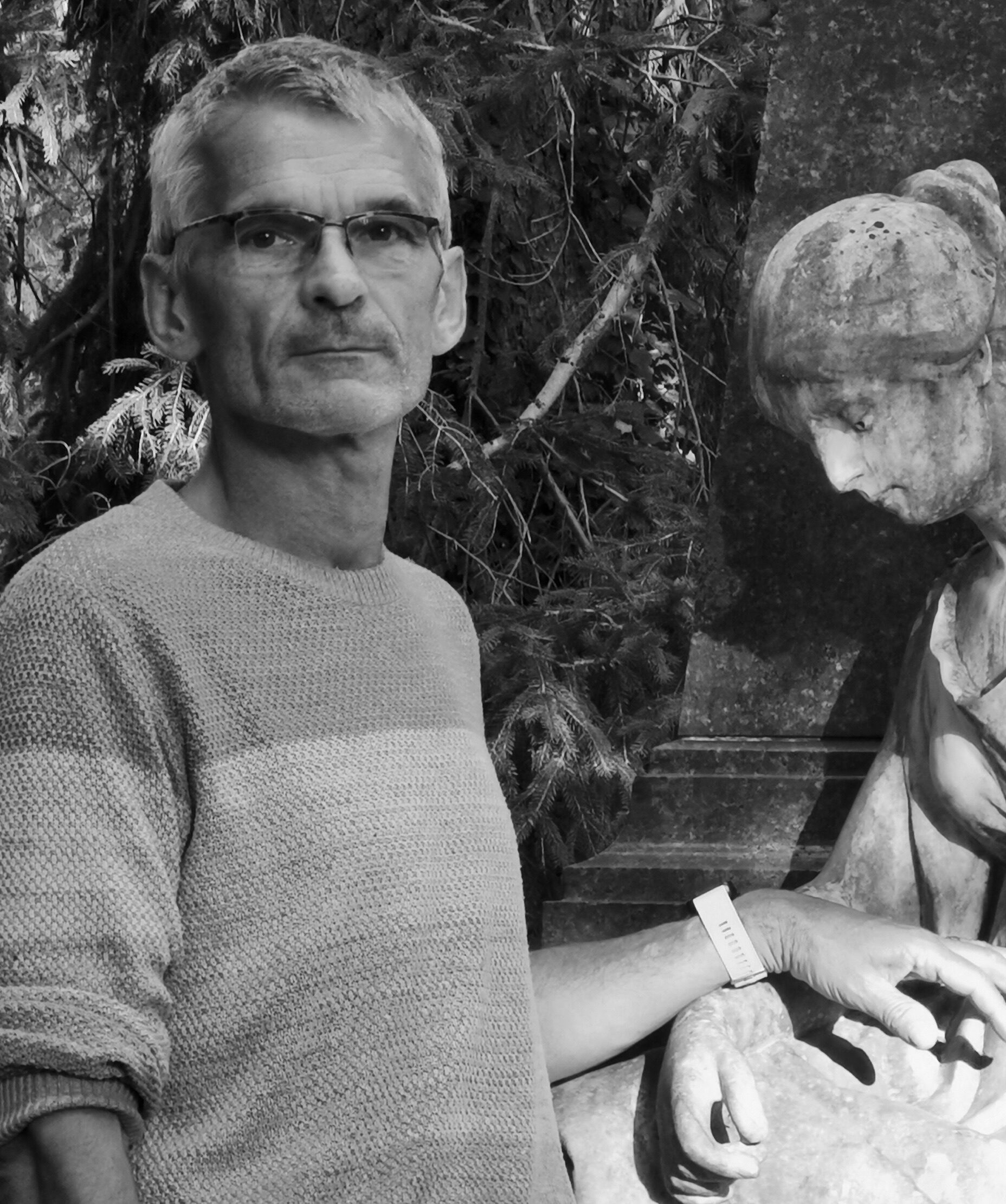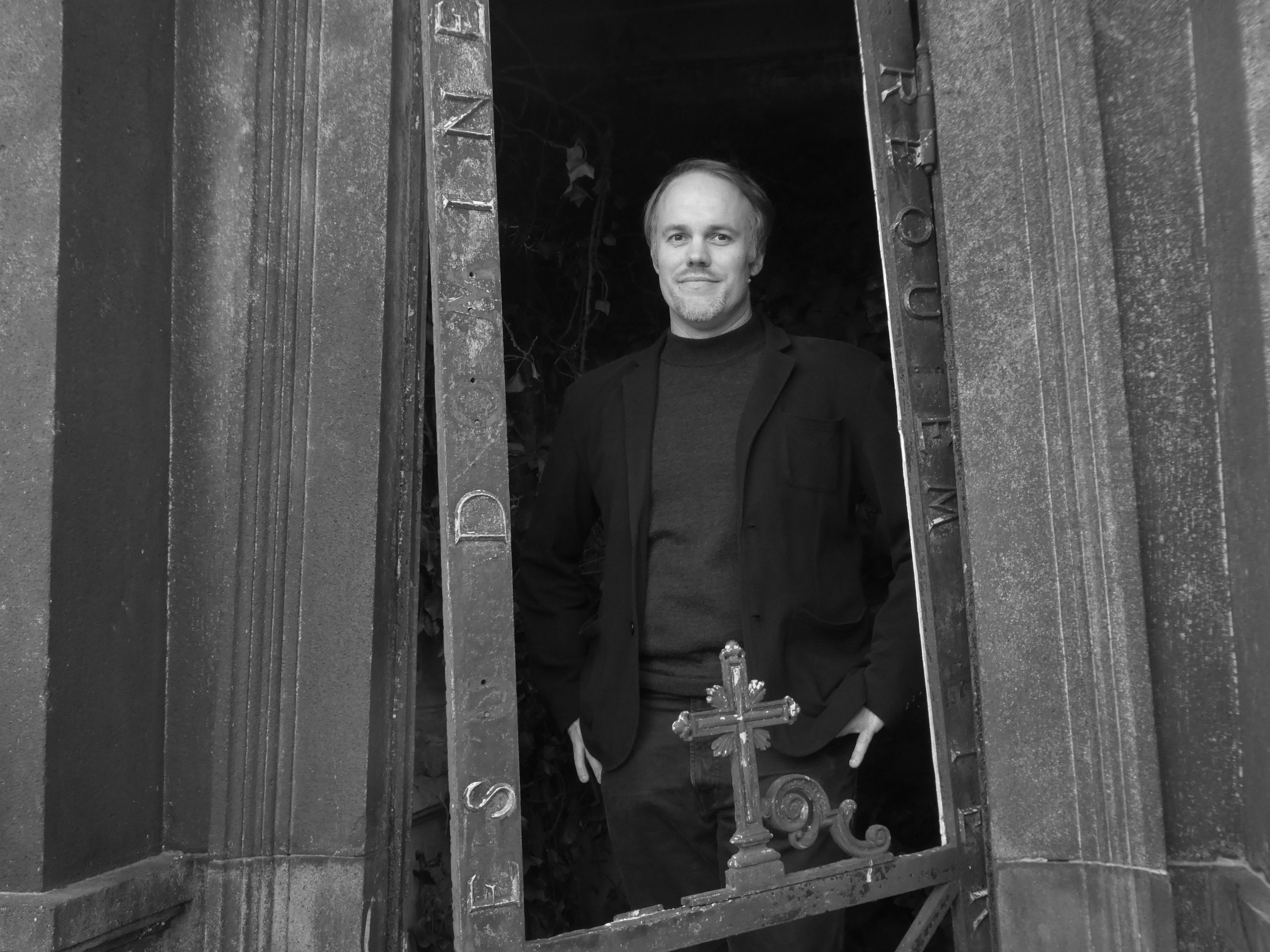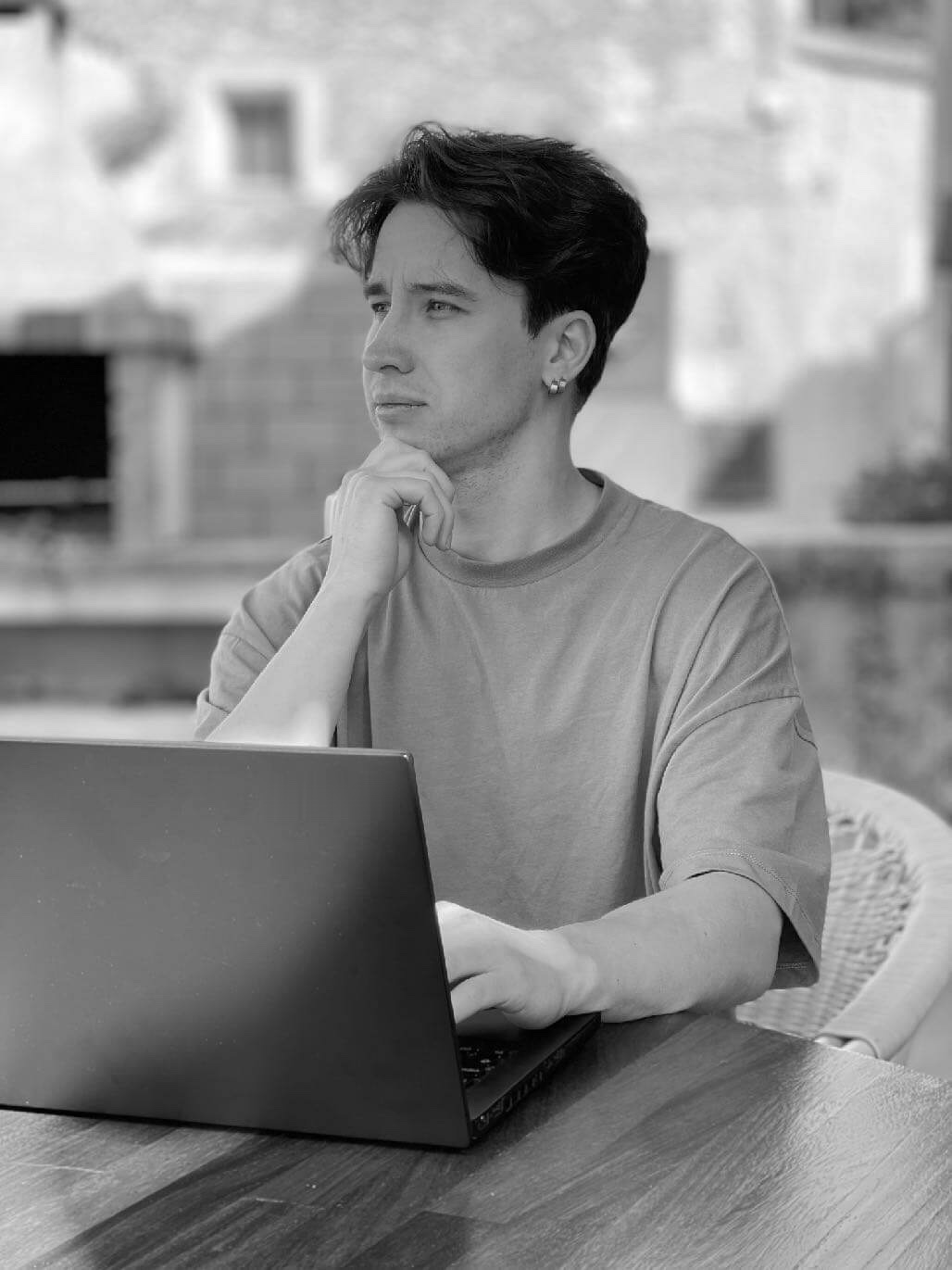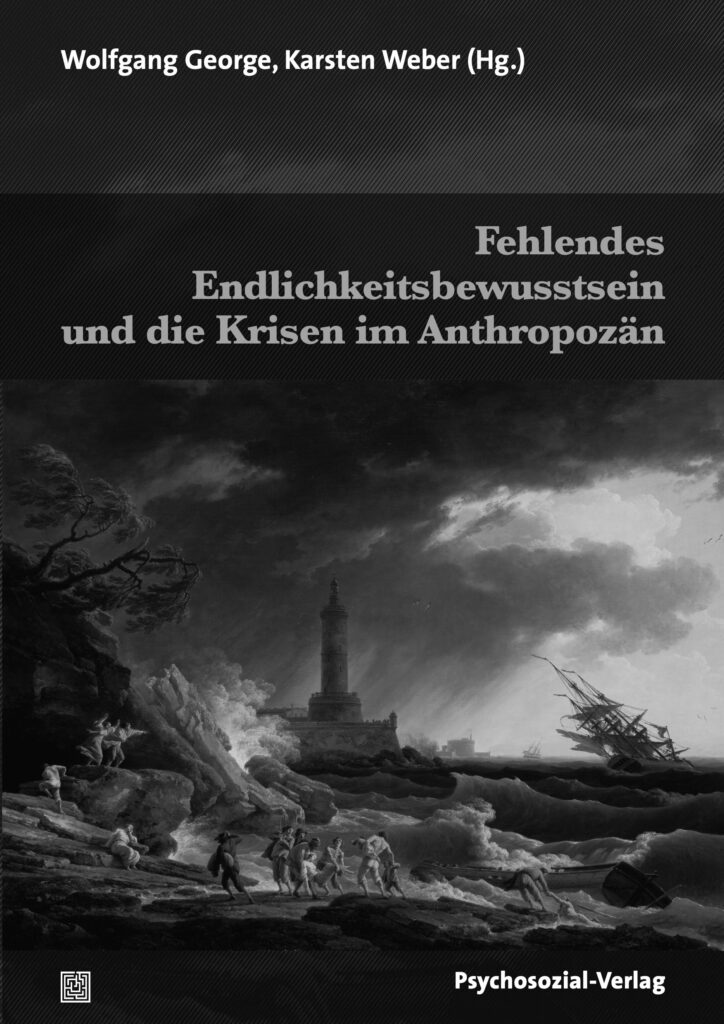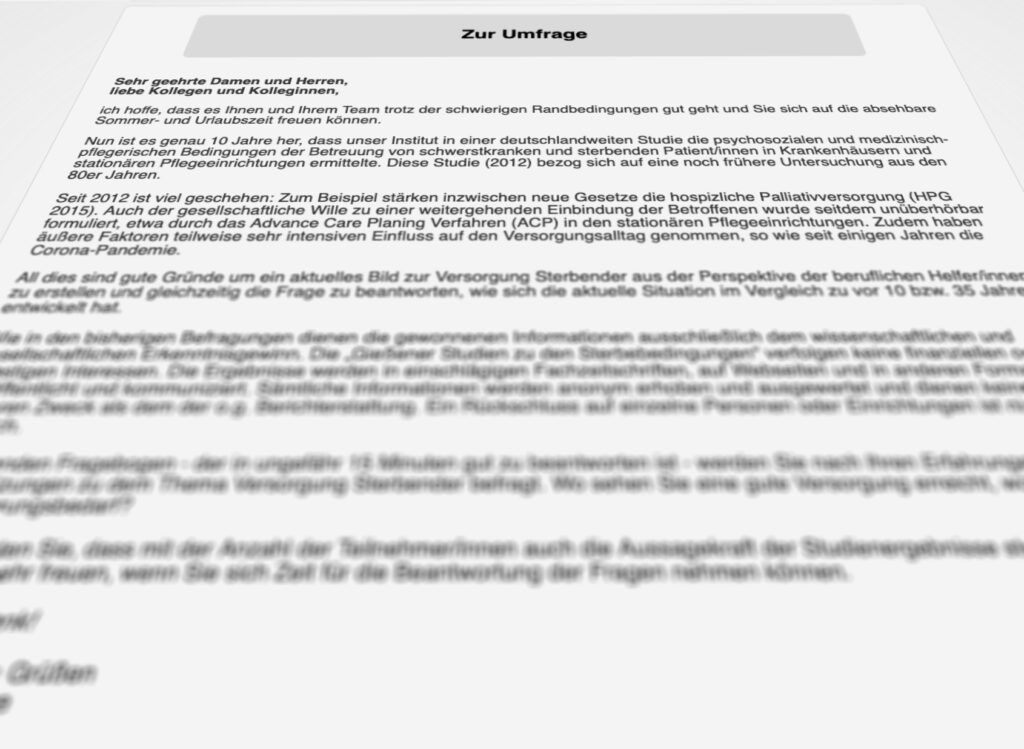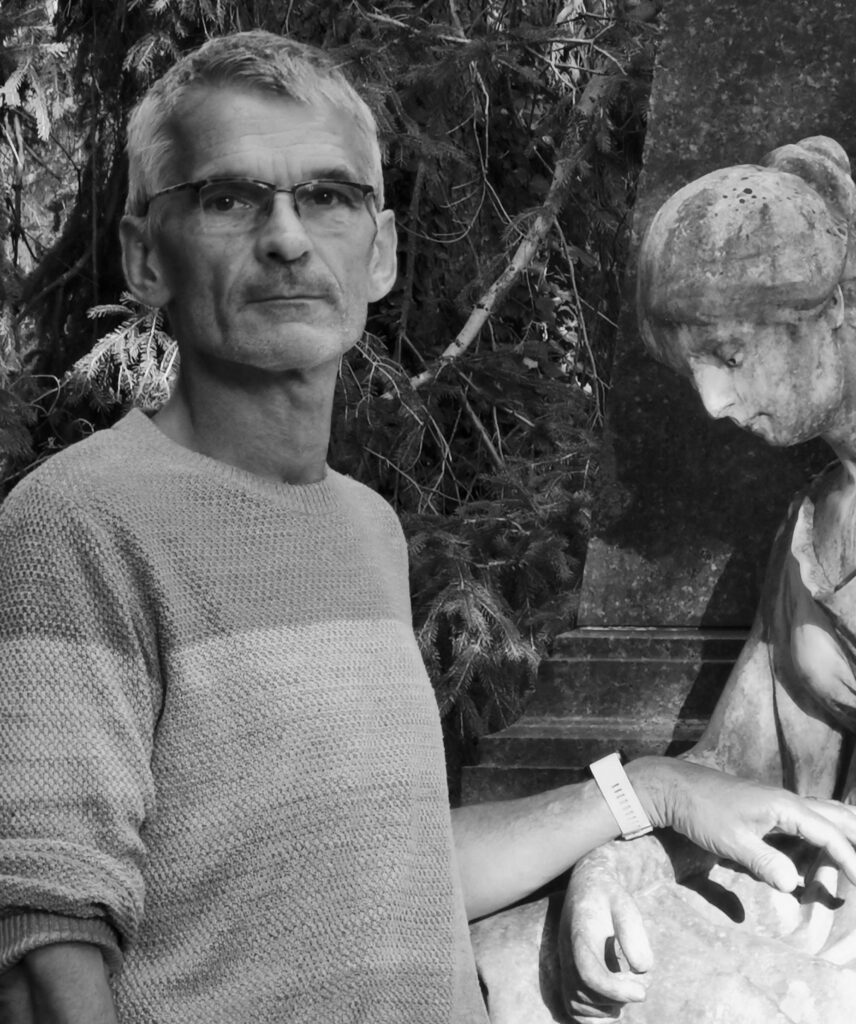Den letzten Lebensabschnitt durch eine regional-kollaborative Sorgekultur zukunftsfähig gestalten
Gießen den 01.02.2024 Am 20.3.2024 zwischen 14.00 und 18.00 Uhr bieten wir eine Online-Veranstaltung unter dem Titel: Den letzten Lebensabschnitt durch eine regional-kollaborative Sorgekultur zukunftsfähig gestalten. Ein erfahrenes Referententeam mit u.a. genossenschafts- und kommunalpolitischer Erfahrung wird Wege aufzuzeigen, wie den absehbaren Schwierigkeitslagen entgegengetreten werden kann. Nähere… Weiterlesen